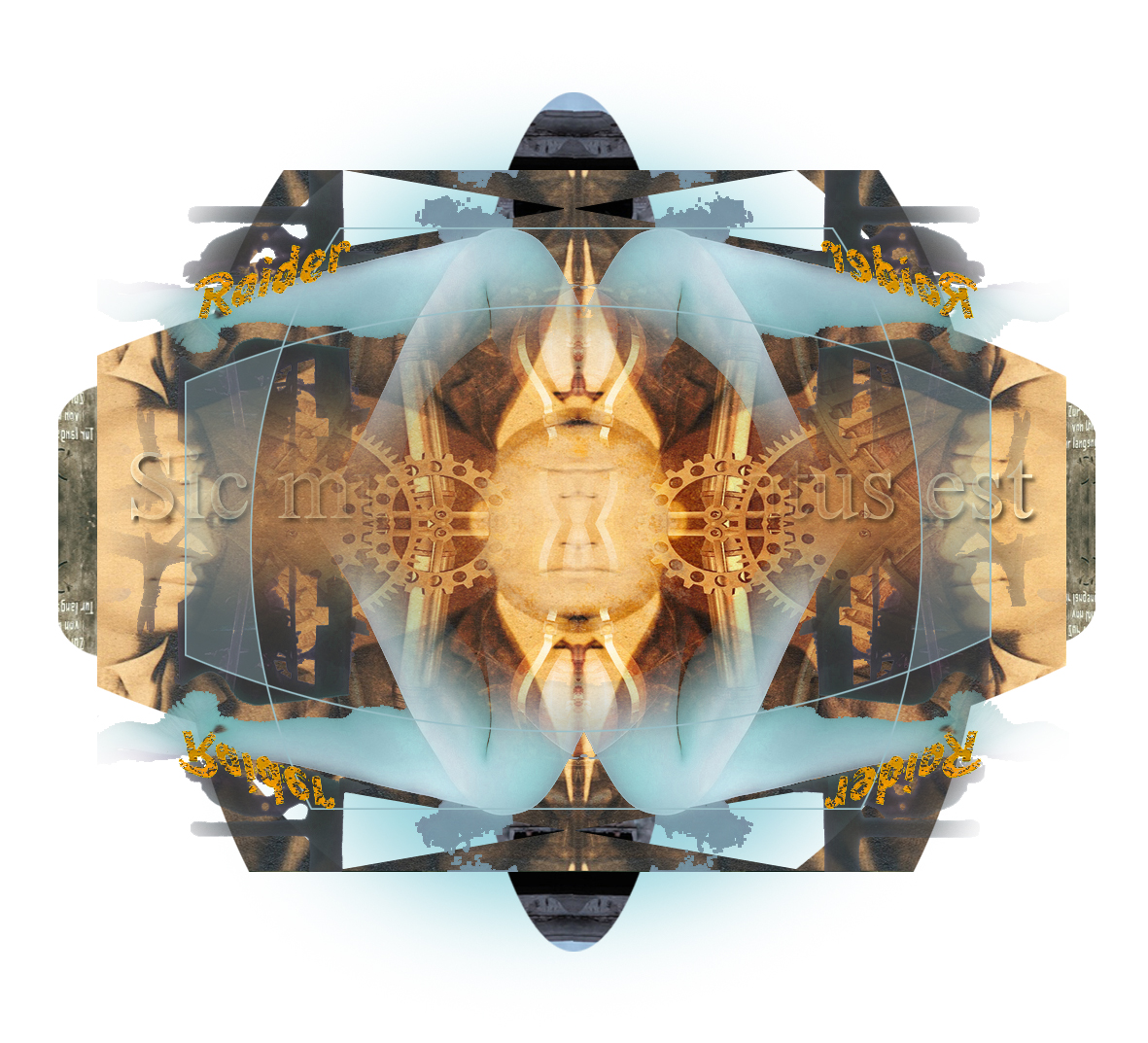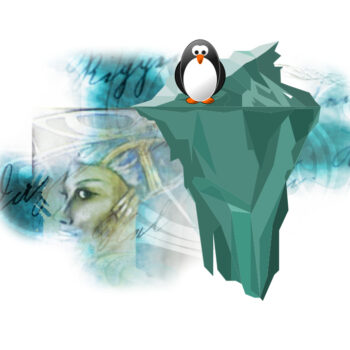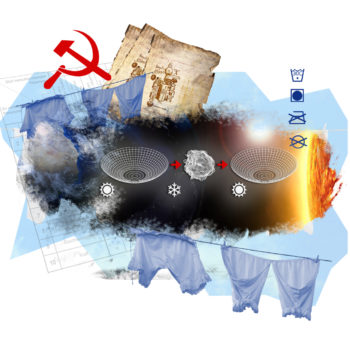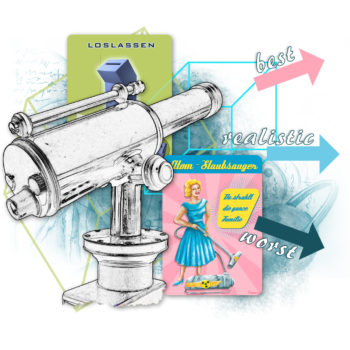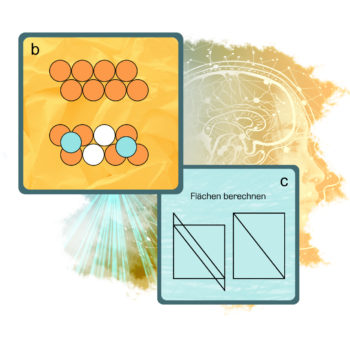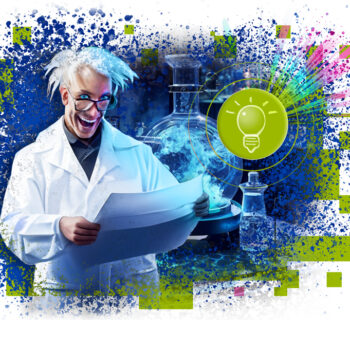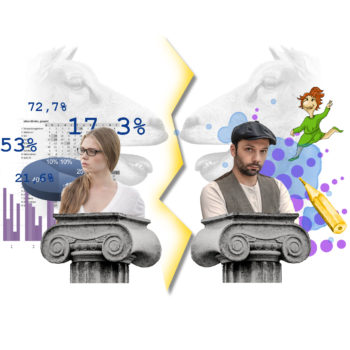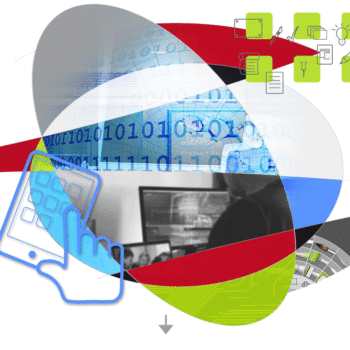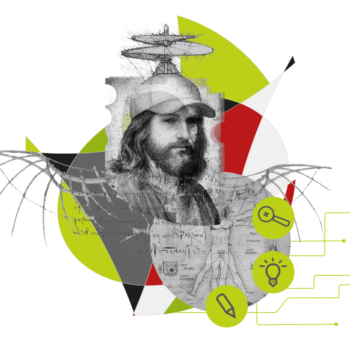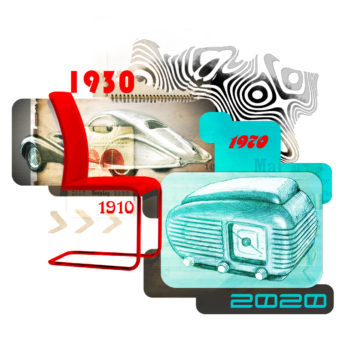Die deutsche Mystery-Serie „Dark“ ist ein gefundenes Fressen für den Kulturpsychologen. Sie bringt die Befindlichkeit unserer Kultur, den Zeitgeist, wie kaum eine andere auf den Punkt.
Kennen Sie „Dark“? Sie ist immerhin eine der erfolgreichsten Netflix-Serien aus Deutschland. Haben Sie die Serie gesehen? Womöglich sogar bis zum Ende der dritten Staffel durchgehalten? Und verstanden??? Wenn ja, Glückwunsch!
Die Handlung ist schnell erklärt – oder auch nicht: Es geht um vier Familien in einer deutschen Kleinstadt namens Winden. Die Geschichte beginnt noch relativ harmlos mit dem mysteriösen Verschwinden von zwei Kindern. Durch Zeitreisen und Reisen in Paralleluniversen gerät zunehmend alles aus den Fugen. Am Ende windet sich in Winden alles um sich selbst, alles hängt mit allem zusammen, und das dermaßen verworren, verwoben und vielschichtig, dass man die Serie kognitiv und emotional kaum noch verarbeiten kann. So ist etwa die Tochter der Mutter gleichzeitig die Urgroßmutter der verschwundenen Schwester. Ihr Urenkel ist gleichzeitig der Vater ihrer Tochter. Diese Tochter ist aber eigentlich ihre eigene Mutter, zudem gibt es sie in ihrer heutigen, vergangenen und zukünftigen Version. So ähnlich jedenfalls.
Unterlegt ist die Story mit einer unheilvollen Atmosphäre und wird durchzogen von einer bedeutungsschwangeren Symbolik: Höhlen, Zeichen, Tagebücher, Uhrmacher, Dachböden – und einer sehr alltäglichen Symbolik: Raider und Twix, gelbe Regenjacken, Bushaltestellen, Pfennige und… Nena.
Was macht die Serie so beliebt? Aus medienpsychologischen Untersuchungen wissen wir, dass simple oder leicht durchschaubare Serienmuster schon länger out sind. Soaps wie GZSZ werden allenfalls noch aus Gewohnheit geguckt. Heute guckt man anders: Komplex und herausfordernd muss es sein, möglichst auch mysteriös und übernatürlich. Als Zuschauer*in will ich etwas zu tun haben, Geheimnisse aufdecken, Fälle auflösen, Sinn entwickeln, Zusammenhänge verstehen, bis ich am Schluss alles durchschaut und verstanden habe, und mit dem guten Gefühl entlassen werde, mit der Komplexität selbst, gewissermaßen durch eigene Leistung, zurechtgekommen zu sein.
Was hat dies mit dem Zeitgeist zu tun? Zunächst spiegelt die Serie die reale Welt, wie sie von vielen schon seit längerem erlebt wird: Als undurchschaubar, alles mit allem verwoben und latent bedrohlich. Dafür gibt es übrigens den schönen Begriff „VUCA-Welt“: VUCA steht für volatility, uncertainty, complexity und ambiguity. Seit Corona ist unsere Welt sogar noch mehr VUCA. Zugleich machen solche Serien den Zuschauer*innen das Angebot, stellvertretend diese komplexe Welt zu behandeln: Zusammenhänge zu durchschauen, einen Sinn hinein zu bekommen. Das gibt das gute Gefühl, irgendwie mit der komplexen Welt zurande zu kommen, und wenn es nur auf einem fiktiven Nebenschauplatz wie einer Netflix Serie geschieht.
Das gibt es aber schon bei vielen Serien. Bei Dark ist neu, dass die Serie erstens dieses Prinzip auf die Spitze treibt. Zweitens bietet sie unterschwellig auch noch eine andere Lösung an: Die komplexe Welt gänzlich zu zerstören, anstatt sie „nur“ zu durchschauen und zu entwirren. In der Handlung manifestiert sich dies u.a. an der „Apokalypse“ und dem Versprechen des „Paradies“. Das Paradies ist letztlich das Nichts, die Auslöschung des Knotens, mit dem alles begann und damit die Vernichtung der Welten von Jonas, Martha und all den anderen. Sie bedient die Sehnsucht, diese ganze komplizierte, undurchschaubare, unberechenbare VUCA-Welt hinter sich zu lassen. Weg damit! Aber auch das bleibt nicht unwidersprochen stehen.
Denn was uns das Ende der Serie zeigt, ist zwar die reale, einfache und normale Welt. Aber sie ist sowas von normal! Um nicht zu sagen stinknormal und stinklangweilig. Da sitzen in der letzten Einstellung der letzten Folge der letzten Staffel die uninteressantesten Charaktere der Serie wie eine amerikanische Spießerfamilie zu Thanksgiving zusammen. Keine Zeitreisen, Parallelwelten, Knoten und Abenteuer mehr, kein Mystery, keine Helden, keine Verwicklungen, und alle sind furchtbar nett zueinander. Die Zuschauer sind teils erleichtert – jetzt muss man auch nicht mehr alles verstehen – teils richtig enttäuscht. Trotz der Auflösung und Klärung haben alle Spaß daran, die verzwickten Zusammenhänge in Foren bis ins letzte Detail zu diskutieren. Die Serie wirbt damit letztendlich für die Komplexität unserer Gegenwart. Einfache Lösungen können auch enttäuschen. Wie in der realen Welt. Sic mundus creatus est.