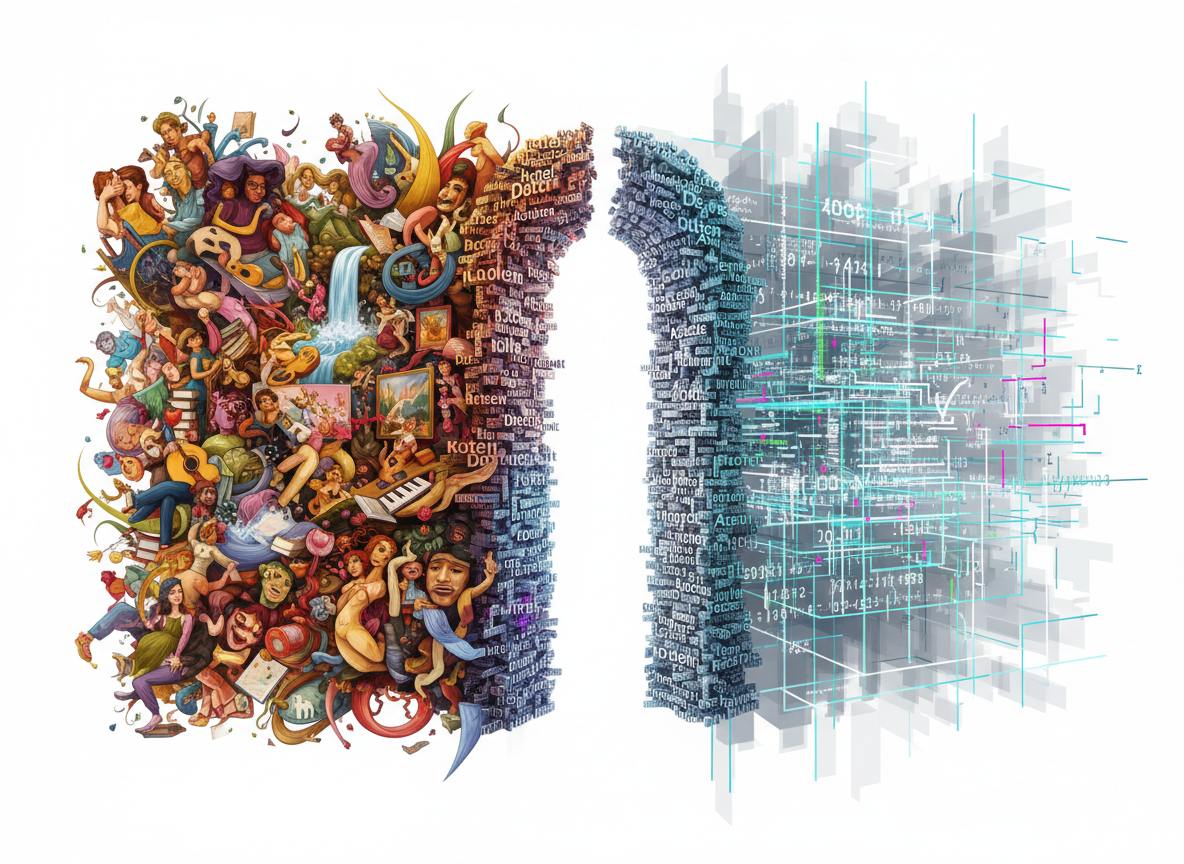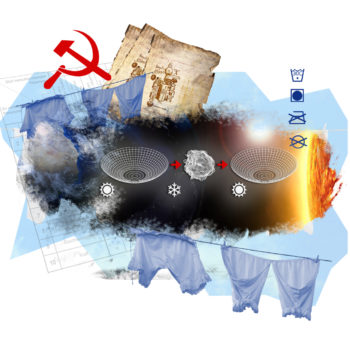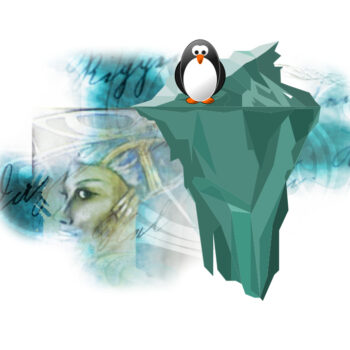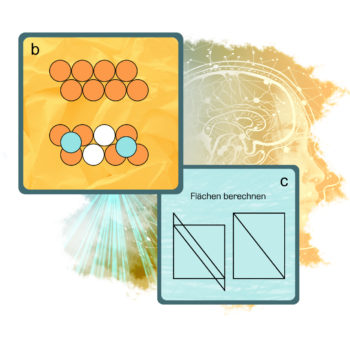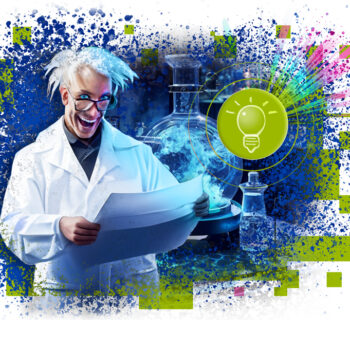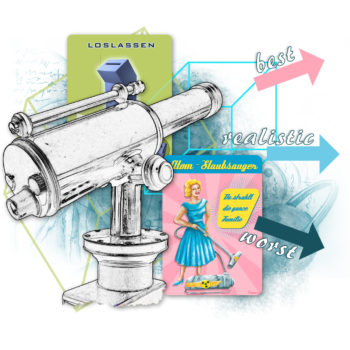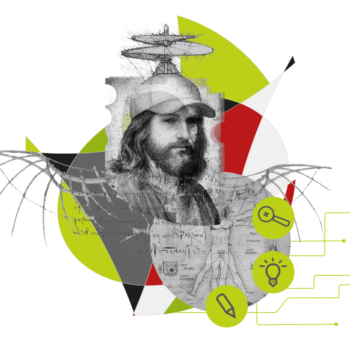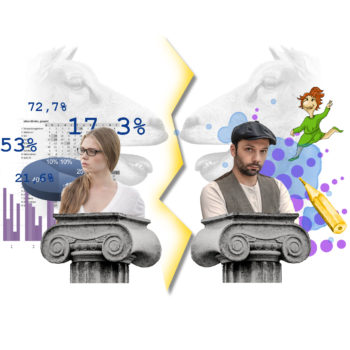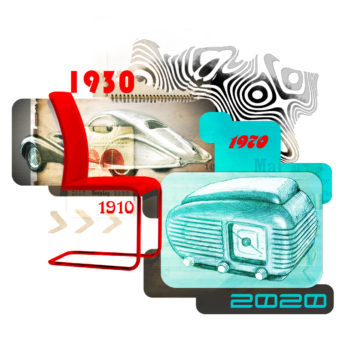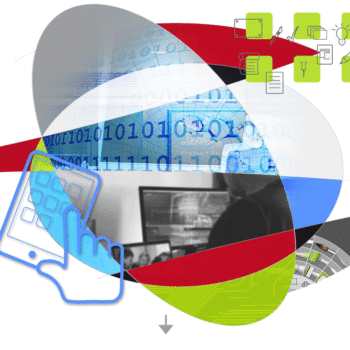Das Not-invented-here-Syndrom beschreibt die Tendenz, Ideen und Konzepte abzulehnen, wenn sie nicht selbst entwickelt oder zumindest mitentwickelt wurden, unabhängig davon, ob sie gut sind oder nicht. Ein Blick in den Maschinenraum des iterativen und co-kreativen Prozesses von consumerLabs zeigt, wie es anders geht.
Es ist vermutlich in jedem Unternehmen bekannt: Es wird eine neue Kampagne präsentiert, eine neue App oder Landing Page gestaltet oder ein Produktkonzept vorgestellt. Doch auch, wenn die Idee oder das Ergebnis qualitativ gut ist, hapert es dann an der Umsetzung. Manchmal verschwindet ein innovatives und an sich gutes Konzept sogar auf Nimmerwiedersehen in der Schublade. Gerade wenn externe Dienstleister Ideen, Konzepte oder Entwürfe ‚von außen‘ ins Unternehmen tragen, ist die Gefahr groß, dass das Not-invented-here-Syndrom zuschlägt.
Ownership ist entscheidend
In vielen Fällen hat dies nichts mit Innovationsfeindlichkeit zu tun. Es geht um Ownership, das Gefühl, selbst Teil der Entstehung gewesen zu sein, oder eben nicht. Wer an einem Konzept direkt mitgearbeitet hat, Arbeit und Herzblut hineingesteckt hat, der ist viel eher bereit, es zu verteidigen, es anderen Abteilungen gegenüber zu verargumentieren und nicht zu schnell Widerständen im Unternehmen bei der Umsetzung nachzugeben. Das alles gehört gerade in größeren Unternehmen dazu, eine Idee voranzutreiben und am Ende auch zu implementieren.
Was offensichtlich hilft, aber in der Praxis gerade von Dienstleistern oft zu wenig beherzigt wird, ist, die verantwortlichen Personen aktiv am Entwicklungsprozess zu beteiligen. Das bedeutet nicht, dass jeder alles selbst entwerfen muss. Prozesse sollten aber so geplant sein, dass alle relevanten Stakeholder von Beginn an am Entwicklungsprozess beteiligt sind und alle wichtigen Entstehungsschritte miterleben und mitgestalten können. Dann entsteht ein Gefühl gemeinsamer Autorenschaft, was die Umsetzungswahrscheinlichkeit enorm erhöht.
Ein Blick ins consumerLab
Gute Erfahrungen haben wir jetzt bereits seit einigen Jahren mit dem Format des consumerLabs (oder CXLab, oder DesignLab, je nach Kunde und Zielsetzung) gemacht, und der hier als Beispiel dafür dienen soll, das Not-invented-here-Syndrom von vorneherein zu vermeiden. Worum geht es in einem Lab? Ein Lab ist ein gemeinsamer Entwicklungsprozess mit dem Ziel, einen Mehrwert für ein Produkt, eine Vermarktungsstrategie oder eine Customer Journey zu entwickeln, um Conversion zu steigern. Das Ergebnis sind konsumentenzentrierte Design-Prototypen in Form von (i.d.R. klickbaren) Mockups. Das kann z.B. ein Online-Banner sein, eine Online-Bestellstrecke, eine Landing Page oder die Architektur und das Design einer App.
In solch einem Lab, der i.d.R. etwa 2 Wochen dauert, wechseln sich Mockup-Entwicklung, Workshops mit Konsument:innen, psychologische Analyse und Team-Reviews iterativ ab. Meist drehen wir 3 oder 4 Schleifen, bis ein finales, dann bereits am consumer getestetes Mockup steht – ein Prototyp, der direkt in der Vermarktung genutzt werden kann. Wichtig für das Gelingen des Prozesses ist dafür:
👉 Alle Teilnehmer:innen sind im gesamten Prozess bei allen Schritten aktiv beteiligt. Bei einem zweiwöchigen Prozess ist dies i.d.R. gut realisierbar.
👉 Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer kann und sollte jederzeit seine Gedanken, Ideen oder auch Textformulierungen oder Bilder einbringen. Gerade am Anfang des Prozesses (die „All-In Phase“), wenn noch nicht klar ist, in welche Richtung sich ein Konzept entwickelt, sollte wirklich alles in die Consumer-Workshops testweise mit reingegeben werden.
👉 Ein klar strukturierter Prozess mit definierten Meilensteinen sorgt dafür, dass sich niemand Gedanken machen muss, wie der Prozess weitergeführt ist, oder ob das Timing noch stimmt: Beginnend z.B. mit einer Analyse von Produkt und Zielgruppe, der Erstellung von Routen und systematisch variierten Mockups, über eine schrittweise Reduzierung und Überarbeitung des Materials bis hin zum finalen Entwurf.
👉 Agilität bei „wicked problem“ erhalten. Entwicklungsprozesse müssen dabei flexibel bleiben, um bei Bedarf die Zielsetzung zu ändern. So wurde z. B. in einem Lab aus einer geplanten App nach der zweiten Phase eine Webseite, weil diese von den Kunden deutlich besser angenommen wurde.
👉 Team-Reviews in jeder Phase schaffen maximale Transparenz und sorgen dafür, dass alle aktiv beteiligt bleiben: Das betrifft die gemeinsame Analyse des Kundenfeedbacks als auch die Entscheidungen, wie das Material für die nächste Phase überarbeitet wird. Ggf. müssen zwischen den Phasen auch Infos von angrenzenden Verantwortungsbereichen eingeholt werden.
👉 Aktive Beteiligung auch zwischen Reviews und Workshops ermöglichen. Im Lab passiert dies meist, wenn wir Mockups nach Absprache im Review überarbeiten. Jeder erhält dann den Link zur Adobe Cloud und zu einem Kollaborationsboard mit der Möglichkeit, Anmerkungen zu hinterlassen.
Das so gemeinsam erarbeitete Ergebnis wird dann in aller Regel 1:1 umgesetzt, da es nicht nur human-centered in Bezug auf die Konsument:innen ist, sondern auch human-developed durch das verantwortliche Team. Nicht zuletzt nehmen alle Beteiligten noch nachhaltige Lerneffekte mit. Sie können nicht nur den gemeinsam entwickelten konkreten Entwurf besser im Unternehmen verkaufen. Sie wissen auch noch etwas besser, worauf es bei der Vermarktung ihres Produkts ankommt, und können ihre Erkenntnisse auch auf andere Journeys oder Vermarktungskanäle übertragen. Sie werden empowered durch knowing-how, zusätzlich zum knowing-what (der entwickelte Prototyp).
Wenn Beteiligung fehlt
Wie wichtig die aktive Beteiligung ist, zeigt sich auch an einem eigenen Beispiel, das nicht so optimal gelaufen ist. In dem Fall sollte eine Print-Anzeige iterativ entwickelt werden. Weil die Zielgruppe schwieriger zu finden war, wurden statt Workshops (die alle live verfolgen können) immer einige wenige Einzel-Interviews zwischen den Review- und Kreationsphasen durchgeführt. Auch hier gab es ein Ergebnis, das human-centered war. Dennoch wurden die Entwürfe nicht so richtig angenommen. Hinter den uns dafür genannten Gründen dafür war auch rauszuhören: Es war nicht so richtig das eigene Baby.
Wie ist das mit KI?
Generative KI-Tools können dabei unterstützen, innerhalb kürzester Zeit Testmaterial zu entwerfen, sie geben Inspiration für Claims und Texte oder ermöglichen es, Bildideen aus dem Team schneller umzusetzen als mit klassischen Tools. Kann KI aber nicht auch den ganzen Prozess abkürzen? Abgesehen davon, dass weder echtes Kundenfeedback simuliert werden kann noch der Transfer von psychologischen Insights in konkrete Mockups gut gelingt – eine Abkürzung durch KI würde auch den „human-to-human“-Ansatz zunichte machen. Das Ergebnis wäre dann auch wieder „not invented here“ – oder: Not my baby.