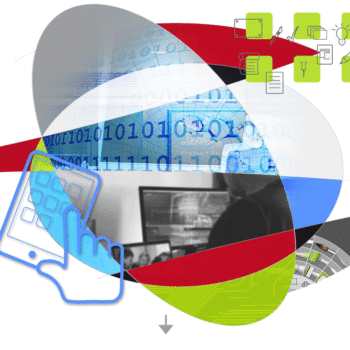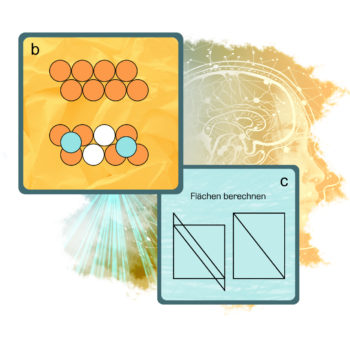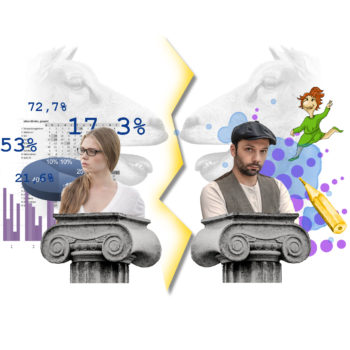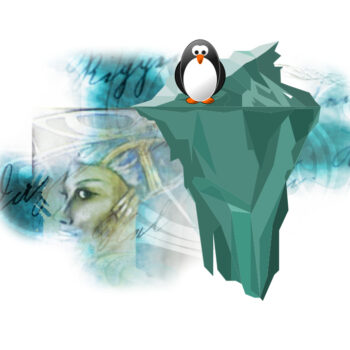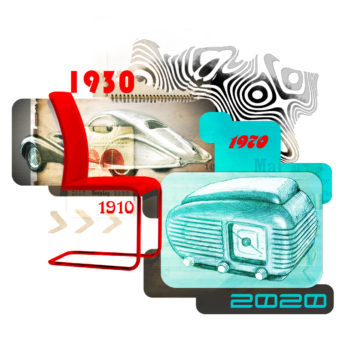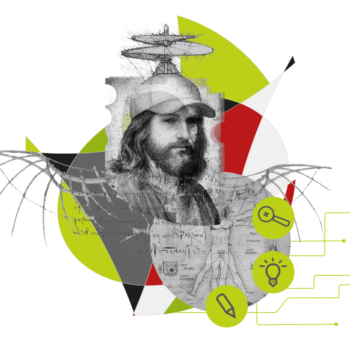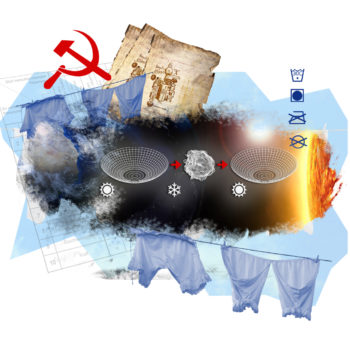Co-Creation und Crowdsourcing versprechen eine Abkürzung, um zu nutzerorientierten Ideen zu kommen, haben aber einige Fallstricke.
Wie kommt man am schnellsten zu nutzerorientierten Ideen? Man fragt die Nutzer*innen bzw. Konsument*innen einfach direkt nach ihren Ideen oder entwickelt sie mit ihnen gemeinsam. Ideen, die von den Nutzer*innen selbst erdacht werden, müssen doch auch zwangsläufig welche sein, die sie dann auch begeistert kaufen. Klingt logisch, ist aber leider nicht ganz so logisch wie es klingt.
Zunächst ist es natürlich richtig, dass man Innovationen, wenn sie auch erfolgreich sein sollen, nicht an den Menschen, die sie kaufen sollen, vorbei entwickeln sollte. Die Nutzer*innen können eine wertvolle Quelle für Ideen sein, die man auch nutzen kann. Vor allem, wenn es um Verbesserungsideen geht, wissen oft die Nutzer*innen, die täglich mit dem Produkt umgehen, am besten, was daran noch suboptimal ist. Das kann man über Co-Creation oder auch Crowd-Sourcing herausfinden. Dabei ist aber auch zu bedenken, dass speziell Crowd-Sourcing nicht sehr effizient ist. Crowd-Sourcing lebt – wie der Name schon sagt – von der Menge. Wenn es gut läuft, hat man jede Menge Input, der dann erst einmal ausgewertet werden muss.
Wenn es sich um psychologisch relevante Innovationen handelt, oder um disruptive, also besonders revolutionäre Neuentwicklungen, dann sind Konsument*innen nicht unbedingt die besten Ideengeber.
Psychologisch relevante Ideen
Bei psychologisch relevanten Ideen handelt es sich um solche, die technisch gar nicht unbedingt so besonders modern oder ausgefeilt sein müssen, aber dem Nutzer psychologisch etwas zumuten. Die Zumutung kann auf zwei Ebenen der Fall sein.
- Manchmal: Zumutung durch peinliche Probleme:
Es geht um die Lösung von Problemen im Bereich peinlicher Wünsche. Die Einleitung der Co-Creation-Gruppe könnte dann so aussehen: „Heute möchten wir mit Ihnen über Erektionsprobleme sprechen“ oder wahlweise über „Inkontinenz“, oder „Ihr Versagen, warum Sie es nicht zu einem schicken Eigenheim gebracht haben“ … - Häufiger: Zumutung durch eine geforderte Verhaltens- und Gewohnheitsänderung:
Jeder kennt das vermutlich im Bereich Software: Eine neue tolle Programmversion mit neuen tollen features. Sie wäre jedenfalls toll, wenn man sich in der neuen Version noch zurechtfinden würde, und dann heißt es „rtfm“ (read the fucking manual). Gewohnheiten sind sehr nützlich. Sie beschleunigen Prozesse und vermeiden Fehler. Man kann es den Menschen daher auch nicht zum Vorwurf machen, wenn sie auf ihre Gewohnheiten Wert legen.
Ideen, die später faszinieren, können anfangs auch beängstigen oder überfordern und werden daher zunächst abgelehnt. Die psychologischen Motive für Kauf und Verwendung eines Produktes sind den Konsument*innen zudem größtenteils nicht bewusst. Sie können daher auch keine Ideen bezogen auf ihre psychologischen Motive entwickeln. Zum zurückhaltenden Verhalten in einem Co-Creation Prozess trägt auch erschwerend bei, dass die Teilnehmer*innen sich nicht in einem vertrauten Team befinden und bei ungewöhnlichen Ideen Angst haben, sich zu blamieren oder bloßzustellen.
Disruptive Ideen
Sind die Konsument*innen mit dem Bestehenden zufrieden, fehlt ihnen schon die Motivation, über Ideen nachzudenken. Es sind auch nicht die Konsument*innen, die unter Innovationsdruck stehen, sondern das Unternehmen. Ein hohes Engagement der Konsument*innen bei der Ideenentwicklung kann man daher nicht immer voraussetzen. Nicht selten wird in Co-Creation-Gruppen von Teilnehmern die Frage gestellt, warum sie denn für lau für das Unternehmen Ideen entwickeln sollen.
Ideen entstehen oft auf der Basis einer langen und intensiven Beschäftigung mit einem Thema und brauchen lange für die Entwicklung. Die Konsument*innen beschäftigen sich nur kurz und oberflächlich damit. Sie sind auch i.d.R. keine kreativen Profis, die im Denken ungewöhnlicher Möglichkeiten geübt sind. Vorstellungsvermögen und leidenschaftliches Interesse am Thema können ebenfalls nicht vorausgesetzt werden
Sog. „Leaduser*innen“ sind zwar ggf. informierter und engagierter. Sie sind aber nicht repräsentativ für die Masse der Konsument*innen. Hat man kreative Konsument*innen in der Gruppe (z.B. aus kreativen Berufen), profilieren sie sich ggf. mit besonders pfiffigen oder witzigen Ideen, die dann jedoch nichts mehr mit ihrer Rolle als Konsument*innen zu tun haben.
Crowdsourcing
Der Vorteil beim Crowd-Sourcing, das oft auf Internetplattformen durchgeführt wird, ist, dass man Zugriff auf eine große Menge an Ideenentwicklern*innen hat. Das kann die Chance erhöhen, viele verschiedene Ideen zu erhalten. Quantität ist aber nicht gleich Qualität. Nur weil mehr Ideengeber*innen teilnehmen, müssen die Ideen nicht vielfältiger sein.
Die Anonymität ist ein Vorteil, weil die Teilnehmer*innen sich auch trauen, ungewöhliche Ideen beizusteuern. Man weiß hier aber noch weniger, ob sich die Teilnehmer*innen intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Ob die Ideengeber*innen ihre Ideen ernst meinen, dem Unternehmen mit absichtlich schlechten Ideen vielleicht sogar schaden wollen oder sie sich nur einen Spaß machen, ist ebenfalls fraglich. Dafür gibt es sogar einen Begriff: Crowdslapping. Ein Beispiel dafür ist das Crowd-Sourcing-Debakel um „Pril Brathähnchen“ (einfach mal danach googlen).
Lässt man die Ideen auch direkt per Voting bewerten und lobt noch einen Preis aus, besteht die Gefahr, dass die Teilnehmer*innen mit ihren Ideen gewinnen, die die meisten Facebook-Freunde zum Voting mobilisieren konnten. Das müssen aber nicht unbedingt die besten Ideen sein.
Konklusion
Co-Creation kann sehr gut als projektives Verfahren eingesetzt werden, denn aus den Ideen der Konsument*innen lassen sich in der psychologischen Analyse oft die Bedürfnisse ausfindig machen, die hinter den Ideen stecken. Als Vorbereitung auf Innovations-Workshops mit Mitarbeiter*innen kann Co-Creation sehr hilfreich sein, um die kreativen Fragestellungen für die Ideenentwicklung nutzerorientierter zu formulieren. Auch für Verbesserungsideen von bereits vorhandenen Angeboten funktioniert es gut.
Es ersetzt jedoch nicht die systematische Ideenentwicklung durch die Mitarbeiter*innen des Unternehmens, zumal es ja auch noch andere Grundlagen braucht, um passende Ideen für eine Marke zu entwickeln. Dazu gehört z.B. die strategische Ausrichtung, die man als Unternehmen anstrebt und die Frage, ob Ideen positiv auf das Markenimage einzahlen.